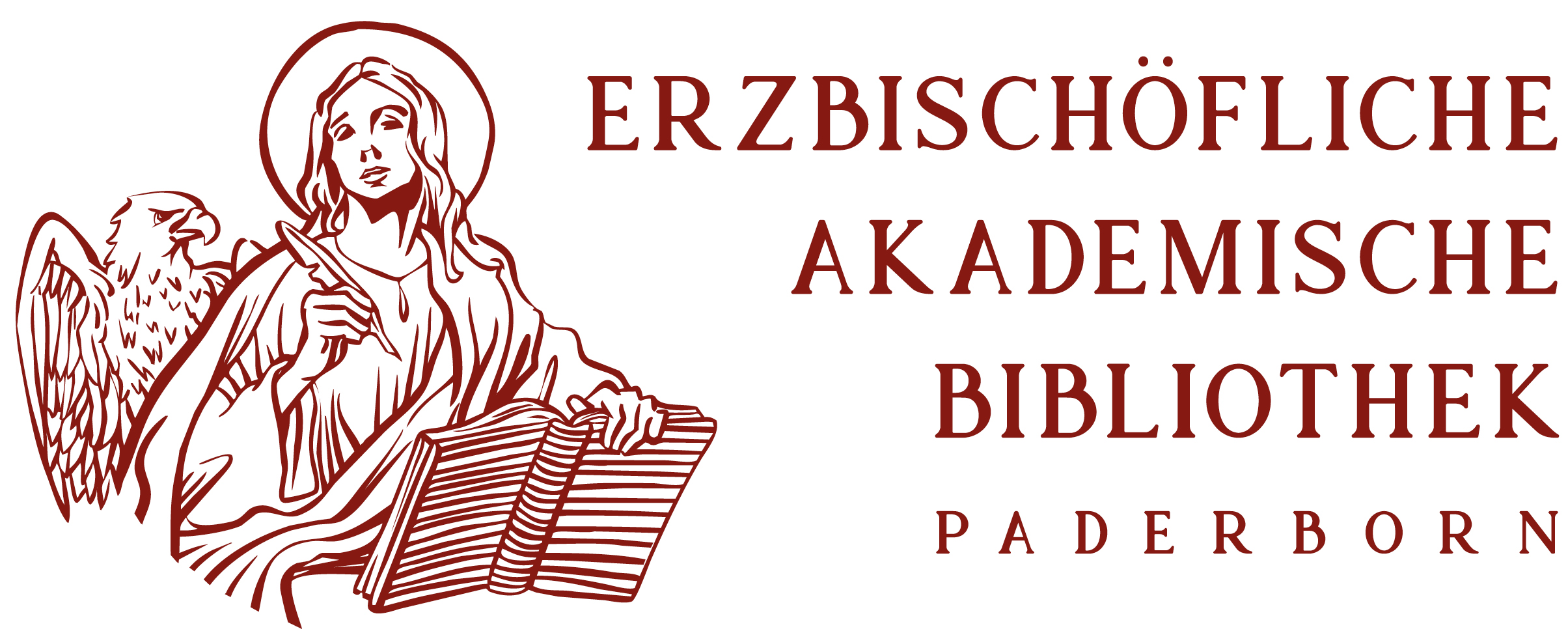Die Institution „Akademische Bibliothek“ ist ein Ergebnis des Kulturkampfes (1874–1887). Die bis dahin bestehende Zusammenarbeit zwischen dem staatlichen Gymnasium und der kirchlichen Lehranstalt für die Priesterausbildung auf bibliothekarischem Gebiet konnte in der alten Form nicht weitergeführt werden, da sich der Staat weigerte, die für die Priesterausbildung notwendige Literatur zu beschaffen. Als 1887 der Lehrbetrieb durch die Lehranstalt – nunmehr „Philosophisch-Theologische Akademie“ genannt – nach einer 14-jährigen Schließung wieder aufgenommen werden konnte, sahen sich die Professoren genötigt, aus eigenen Mitteln Bücher anzuschaffen. Dadurch entstand mehr durch kontinuierliche Entwicklung als durch Gründung eine Bibliothek, die „Akademische Bibliothek“, d. h. zur Akademie gehörig, genannt wurde. Die ersten Statuten erließ der Bischof im Jahr 1896. Im gleichen Jahr wurden die Buchbestände in das ein Jahr zuvor erbaute Leokonvikt (Wohnheim für die Priesteramtskandidaten während der wissenschaftlichen Ausbildung) überführt.
Diese Bibliothek wurde nun relativ professionell eingerichtet. Bereits seit 1902 nahm sie als eine der ersten kirchlichen Bibliotheken am preußischen, später deutschen Leihverkehr teil. Im Jahre 1913 waren die Bestände auf 35.000 Bände angewachsen, es wurde nun, auch wegen der Übernahme der philosophischen und theologischen Bestände der Bibliotheca Theodoriana, ein eigener Bibliotheksflügel an das Leokonvikt angebaut.
Ein erster Rückschlag kam nach dem Ersten Weltkrieg. Die Bibliothek musste aufgrund des Versailler Vertrages eine Reihe von Handschriften an die Universitätsbibliothek in Leuven (Belgien) abtreten. Die geplante Entschädigung durch das Deutsche Reich wurde durch die Inflation völlig entwertet.
Im Jahr 1930 wurde das Bistum Paderborn zum Erzbistum erhoben, daher nannte sich auch die Bibliothek nunmehr Erzbischöfliche Akademische Bibliothek.
Als gegen Ende des Zweiten Weltkrieges im März 1945 ein alliierter Bombenangriff fast ganz Paderborn zerstörte, hatte dies auch für die Bibliothek verheerende Folgen: die Hälfte des damals bereits auf 150.000 Bände angewachsenen Bestandes wurde vernichtet, das Bibliotheksgebäude schwer beschädigt. Vollständig sind lediglich die Archive, die Inkunabeln und die Handschriften erhalten. Die alten Drucke der Theodoriana konnten leider nur etwa zur Hälfte ausgelagert und damit gerettet werden. Der Wiederaufbau war mühsam, und erst Anfang der fünfziger Jahre konnte der Lesesaal wieder bezogen werden. Vorher jedoch hatte die Bibliothek als eine der ersten den auswärtigen Leihverkehr wieder aufgenommen, die Studenten am Ort wurden zum Teil noch aus den Depots, in die einige Teilbestände ausgelagert worden waren, versorgt. Die zerstörten Bücher wurden, soweit es ging, aus Nachlässen ersetzt. Nach dem Wiederaufbau setzte eine kontinuierliche Entwicklung bis heute ein.
Die gedeihliche Symbiose von Theodoriana und Akademischer Bibliothek führte bis heute insbesondere auf dem Gebiet der Erschließung sowie der Erhaltung und Restaurierung der Altbestände zu umfangreichen Maßnahmen. Durch die Bemühungen des 1987 gegründeten Fördervereins der Erzbischöflichen Akademischen Bibliothek Paderborn e.V. konnte 1993 der Inkunabelbestand in einem Katalog erschlossen werden, der neben den Inkunabeln der Theodoriana auch diejenigen der sonstigen Depositalbestände umfasst. Schwerpunkt der Förderung des Vereins ist jedoch die Restaurierung der Altbestände in der Bibliothek, von denen rund 30 mittelalterliche und zahlreiche neuzeitliche Handschriften sowie über 60 Inkunabeln und eine erhebliche Anzahl von Drucken des 16. und 17. Jahrhunderts restauriert werden konnten.